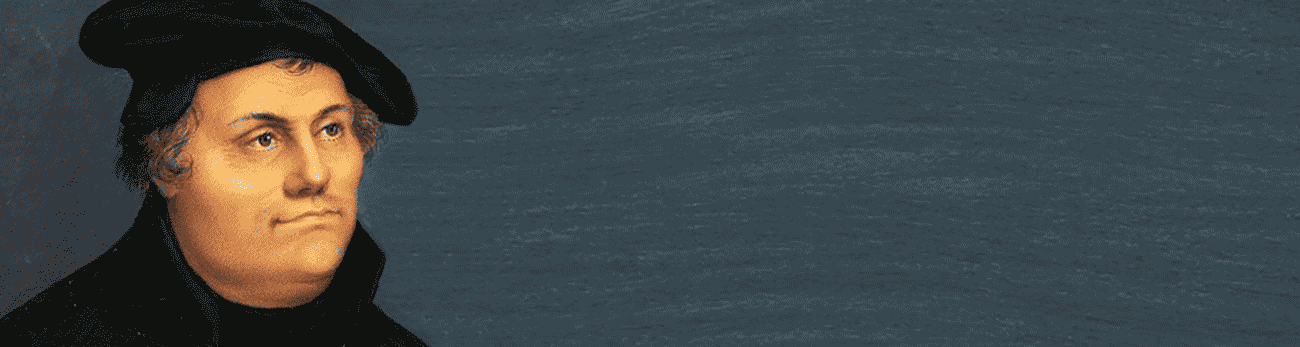Von der Tugendethik zur Ethik des Utilitarismus
Oder: Warum soll ich Gutes tun?
Die Grundproblematik der Philosophie Luthers und die Folgen
Das Verhältnis von Person und Handlung – oder wem nützen oder schaden meine Werke?
Die luthersche Philosophie als Wegbereiterin des Utilitarismus
Luthers problematische Sicht vom Verhältnis zwischen Person und Handlung äußert sich in folgendem Satz:
„Fides facit personam, persona facit opera.“
(Dt.: Erst der Glaube macht die Person, die Person macht die Werke.)
Doch wofür steht hier der Begriff Person?
› Erstens und negativ: Person ist nicht schon der Mensch oder das menschliche Individuum. Das Sein der Person ist überhaupt nichts substanzhaft Bestehendes – im Unterschied zum Sein des Menschen, der etwas eigenständig Wirkliches ist.
› Zweitens und positiv: das Sein der Person besteht allein durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist reine Beziehung und im Akt des Glaubens durch das Erlösungshandeln Gottes konstituiert.
Aus diesen zwei Thesen entsteht die Frage, wie sich dann die menschlichen Handlungen zu dem allein im Akt des Glaubens konstituierten Sein der Person verhalten.
Luthers Antwort auf diese wesentliche Frage hat den Sinn des ethischen Handelns verändert und der utilitaristischen Ethik den Weg bereitet.
Seine Auffassung:
› die sittlichen Handlungen, also die Werke des Menschen, haben keinerlei konstitutive Bedeutung für die Seinsweise der Person. Allein Glaube und Unglaube entscheiden über das Sein der Person vor Gott.
› die Werke oder Handlungen stehen nur in einem konsekutiven Verhältnis zur handelnden Person. Die Person konstituiert die Werke, aber nur der Glaube konstituiert das Sein der Person.
D.h., wir können hier von einem veränderten Begriff des sittlich Guten sprechen, der dem tugendethischen, Personen und Handlung umfassenden Begriff des Sittlichen entgegengesetzt ist und diesen ersetzen soll.
Mit der Trennung von Person und Handlung ist Luther zum Wegbereiter des und utilitaristischen Moralprinzips geworden, das Robert Spaemann so auf den Punkt gebracht hat: „sittlich gut ist, woraus gutes folgt“.
Auch ein Verstoß gegen das natürliche Sittengesetz und die zehn Gebote ist dann gerechtfertigt, wenn daraus mehr Gutes als Schlechtes folgt.
Für Luther ist diese Theologie eine Konsequenz aus seiner These vom unfreien Willen, die den Grundriss seiner gesamten Theologie bestimmt. Der Auseinandersetzung um Freiheit bzw. Unfreiheit des Willens hat Luther darum größte Bedeutung zugemessen.
I. Aus Luthers Thesen von der Unfreiheit des Willens folgt seine neue Sicht der Person als „nos extra nos“: als Person sind wir außerhalb von uns selbst.
Für Aristoteles ist Tugend eine sittliche Qualität der Person, die nicht unabhängig vom Handeln und Leben der Person erworben wird. Um gerecht zu sein, muss man aus freiem Willen um der Gerechtigkeit willen handeln, nicht mal so – mal anders, sondern immer wieder in derselben Weise: um der Gerechtigkeit willen. Für Luther dagegen gilt: der freie Wille ist und bleibt der geknechtete Wille, weshalb die Gerechtigkeit der Person nur ohne Bezug auf ihr Handeln gedacht werden kann. „Nicht in dem wir gerecht handeln, werden wir gerecht, sondern gerecht gemacht durch den Glauben, handeln wir gerecht.“
Was heißt bei Luther „Person“ und „Mensch“?